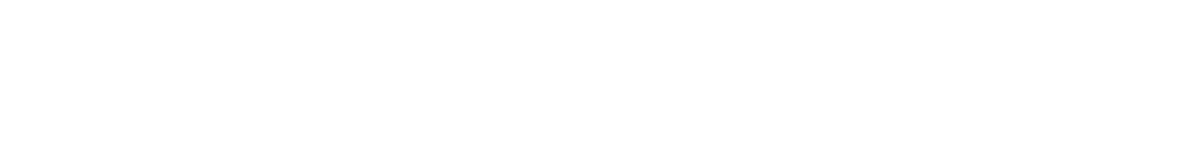Anett Rózsa

|
|
A03
UP1
|
|
Ägyptologie Telefon: +49 (0) 6221/ 542537 |
SFB 933 "Materiale Textkulturen",
Teilprojekt A03-UP1 "Ägyptische Praktiken zur Gewinnung von Gunst"
Anschrift
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Ägyptologisches Institut
Voßstraße 2 (Gebäude 4410)
69115 Heidelberg
Ausbildung
- 2015: B.A. in Ägyptologie, Eötvös Loránd Universität (Budapest, Ungarn)
- 2017: M.A. in Ägyptologie, Universität Heidelberg
- 2018 – heute: Doktorandin / Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Heidelberg, Deutschland) / Philosophische Fakultät, Lehrstuhl für Ägyptologie
Beruflicher Werdegang
- 19.07.2012-27.07.2012: Freiwillige bei einer ungarischen Grabung (Budakalász, mittelalterliche Kirche)
- 11.02.2014-31.01.2015: Fremdenführerin in Museum der Bildenden Künste in Budapest, in der Ägyptischen Sammlung
- 04.05.2014-11.05.2014: Forschung der Bachelorarbeit mit „Campus Hungary Short Term Study Program” (Staatsbibliothek zu Berlin)
- 11.03.2015-30.09.2018: Mitarbeiterin an der „The Campbell Bonner Magical Database” (Museum der Bildenden Künste in Budapest)
- 14.03.2016-13.04.2016: Lehrgrabung in Eisenberg (Römischer Vicus Eisenberg); Universität Heidelberg, Institut für Klassische Archäologie
- 01.09.2016-31.05.2018: Wissenschaftliche Hilfskraft in der Bibliothek des Ägyptologischen Instituts, Heidelberg
- 01.11.2017-06.01.2018: Praktikum im Museum der Bildenden Künste in Budapest, Antikensammlung
- 03.06.2018-bis heute: Fremdenführerin bei „Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg”
Publikationen
- Rózsa, A. (2020) „Gesundheit, Wohlstand und Liebe. Das Sonnenkind auf den Magischen Gemmen”. In: Antike Welt 3/20, 66–70.
- Rózsa, A. unpl. (2023) “Magical gems and their importance for Ancient Studies – Some ‘interdisciplinary’ remarks, problems, and pitfalls”. In: Gemmae: an international journal on glyptic studies.
- Rózsa, A. unpl. „‘Pshai, the god of the gods’ in the Graeco-Egyptian Magical Papyri / Is it possible to change one's fate? In: StudPAP.
- Rózsa, A. et al. unpl. (2023) „Kapitel 2: Layout, Gestaltung, Text-Bild.“ In: Dietrich, N. & Lieb, L. & Schneidereit, N. (Hrsg.), Theorie und Systematik materialer Textkulturen, Berlin/Boston/München.
- Rózsa, A. et al. unpl. (2023) „Kapitel 5: Sakralisierung.“ In: Dietrich, N. & Lieb, L. & Schneidereit, N. (Hrsg.), Theorie und Systematik materialer Textkulturen, Berlin/Boston/München.
- J.F. Quack, A. Rózsa (Hgg.), unpl. Verrätselung von Geschriebenem. Philippika 175, Wiesbaden, in Druck.
Konferenzgespräche/Vorträge
- 06/2023 „When I came into being, the existence came into being” / The χαβραχ-logos in Papyri Graecae Magicae and on magical gems, internationales Kolloquium, “Voces Magicae and the power of the unintelligible”, [geplant mit Publikation]
- 03/2023 Metatext, 10. deutscher Papyrologentag, Heidelberg, Tandemvortrag mit P. Schweizer-Martin (Mittelalteriche Geschichte)
- 02/2023 Some remarks on the ‘Bes-Pantheos’ / ‘Polymorph’ figure on magical gems, internationales Symposium, “The sources of the engravers: Magical gems in a history of image transfers”, Fribourg, in der Schweiz [geplant mit Publikation]
- 07/2022 ‘Psoi, God of all Gods’ in the Graeco-Egyptian magical papyri / Can destiny be avoided or not?, XXXth International Congress of Papyrology, Paris [geplant mit Publikation]
- 03/2022 Favor gaining spells and rituals (general charitesia) with the ‚Solar God’, Materialität, Layout und Formeln: Muster entdecken in den schrifttragenden Artefakten aus Ägypten, Heidelberg
- 11/2021 Magico-medical gems and their importance for Ancient Studies, internationale Konferenz für Doktoranden, die über magische Themen forschen, University College London
- 06/2021 ‘Put the womb of NN to its proper place as (you move) the solar disk!’/ A child deity on the uterine gems, Apotropaia and Phylakteria – Confronting Evil in Ancient Greece, Athens [online]
- 05/2021 Harpocrates vs. The Solar Child. The roles of the Egyptian child deities on a lotus/in a boat (in private, magical practices), Current Research in Egyptology (CRE) 2021, Rhodos [online]
- 02/2020 Kindermedien in Ägypten als Vermittler zwischen Diesseits und Jenseits, „Schrift aus dem Jenseits“ organisiert durch Beatrice Trînca, Heidelberg, SFB 933
- 07/2019 “Harpokrates“ in einem Tierkreis auf Magischen Gemmen, 51. Ständige Ägyptologenkonferenz (SÄK), Basel
- 01/2019 Magical gems to gain favor, ein Vortrag mit einer Klassischen Philologin Barbara Takács, „Antike Welten – Moderne Perspektiven“, Freiburg
Workshopsorganisation
- 03/2022 „Materialität, Layout und Formeln: Muster entdecken in den schrifttragenden Artefakten aus Ägypten“ (SFB 933, Heidelberg), 10–12 März 2022, zusammen mit dem Papyrologischen Institut
Projektbeschreibung
Das Streben nach Erfolg war schon immer eine wichtige Triebfeder des menschlichen Handelns. Eigener Erfolg, Popularität, Beliebtheit, Glück, Reichtum und Liebe sind menschliche Wünsche, welche man durch Anwendung verschiedenster Mittel zu erreichen suchte. Hierzu musste man auch mit anderen Menschen konkurrieren.
Dieses Unterprojekt wird eine Fortsetzung der zweiten Förderphase sein, in welchem unter Berücksichtigung der bisher erarbeiteten Theorien, Fragen, Methoden und Ergebnisse usw. die (magischen) Praktiken gegen Konkurrenten erneut analysiert werden. In der zweiten Phase standen öffentliche Feindvernichtungsrituale und die damit verbundenen Artefakte im Zentrum, in der dritten dagegen die privaten Praktiken zur Gewinnung von Gunst. Eine Möglichkeit um Rivalen auszustechen, ist, ihnen Misserfolge zu verursachen. Im Altertum griff man hierzu zu Verzauberungen und magischen Mitteln. Es finden sich diverse Sprüche und Objekte, welche darauf abzielten, den Gegner zu schädigen.
In Ägypten wurde häufig ein indirekter Weg gewählt: Man versuchte Techniken zu verwenden, welche dem Gegner einen sozialen oder kultischen Tabubruch unterstellen und ihn somit aus der göttlichen Gunst und der Gesellschaft ausstoßen sollten. Nur eine den gesellschaftlichen und kultischen Erfordernissen angepasste, also im religiösen Sinne ‚reine‘ Person konnte auf den Beistand der Götter hoffen. In den zu untersuchenden Quellen wurden Aufforderungen bzw. Bitten an ägyptische, griechische, jüdische und weitere Gottheiten verwendet, um Gunst mittels höherer Kräfte bzw. Wesen zu gewinnen. Darüber hinaus konnte man die magische Kraft mit verschiedenen Amuletten, Substanzen und Pflanzen verstärken.
Ein Hauptziel dieses Unterprojektes ist, die schrifttragenden Artefakte mit ihrer wandelnden Materialisierung ab dem Neuen Reich, in der Spätzeit, der griechisch-römischen und schließlich der christlich-koptischen Zeit –mit Ausblick/en auf die mittelalterlichen arabischen und die jüdischen Quellen– zu analysieren. Zu diesen Artefakten gehörten zahlreiche Handlungsprozesse, wie z.B. die Rezitation, das Kopieren, Lesen und Hören, eine mögliche Wiederverwendung und mehr, welche ebenfalls zu berücksichtigen sind.
Diese zunächst aus dem ältesten Ägypten stammenden Praktiken, Texte und Objekte wurden weitertradiert und ab der Spätzeit bzw. der griechisch-römischen Zeit mit „ausländischen“ bzw. überregionalen Elementen aus dem Mittelmeerraum durchmischt. Entsprechende Artefakte aus unterschiedlichen Kontexten sind Zeugnisse der gegenseitigen Beeinflussung der verschiedenen antiken Kulturen in ihrem regen Austausch miteinander. Diese Artefakte und ihre Praktiken wurden immer anders rezipiert und hatten potentiell auch neue kulturelle Bedeutungen in den verschiedenen materialen Textkulturen inne.
Zu den Artefakten zur Gewinnung von Gunst und Beliebtheit gehören Vertreter umfangreicher Kategorien materieller Zeugnisse, u.a. Briefe, (magische) Papyri, (magische) Handbücher, theoretische Traktate über Steine, Ostraka, Amulette, Grabdekorationen, Tempeldekorationen, Lamellen usw., die neuägyptische, demotische, griechische, lateinische Beschriftungen oder auch Kombination von diesen (auch mehrsprachige bzw. „vergesellschaftete”) als Inschriften tragen und somit zur Bearbeitung eine interdisziplinelle Herausforderung der (Altertums-)Wissenschaften sind. Die magischen Gemmen bzw. Fingerringe der Spätantike und deren ägyptische Motive mit Bitten um Gunst bilden einen großen Korpus der Quellen zur Erlangung des Erfolges in jedem Bereich des Lebens: der sog. Pantheos, das Sonnenkind, Osiris usw. werden als ein sehr wichtiger Aspekt dieser Quellen erneut (quasi als Anknüpfung an die erste Förderphase) berücksichtigt. Wegen der (meist) fehlenden Fundkontexte der Zaubergemmen ist es notwendig, aus den Metatexten zu diesen magischen Objekten Informationen zu sammeln und mit ihnen die (Angaben zu den) real erhaltenen Artefakte zu ergänzen.
Die Artefakte werden quantitativ mit ihren (möglichen) Handlungspraktiken untersucht, aber es werden ebenfalls punktuelle einzelne Praktiken in Betracht genommen. Schließlich wurden diese Traditionen zur Gewinnung von Gunst und Beliebtheit im Mittelalter weitertradiert und verändert. Obgleich die Praktiken zur Gewinnung von Gunst und Beliebtheit bereits bekannt sind, wurden ihre gesellschaftlichen Hintergründe und Aspekte bislang nicht (hinreichend) in der Forschung bearbeitet, obwohl hier wichtige Erkenntnisse zur Glaubens- und Sozialstruktur zu erwarten sind. Dieser fehlenden Bearbeitung soll mit dem vorliegenden Unterprojekt abgeholfen werden, insbesondere mit der Hauptfrage, wie stark magische Praktiken der Gunstgewinnung mit den realen sozialen und privaten Dimensionen der Akteure verknüpft sind?